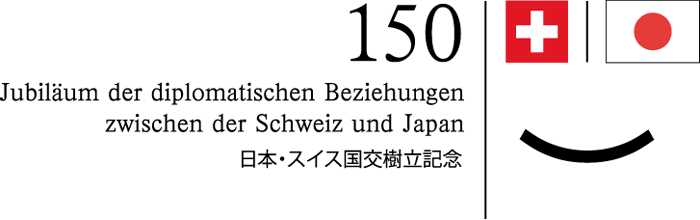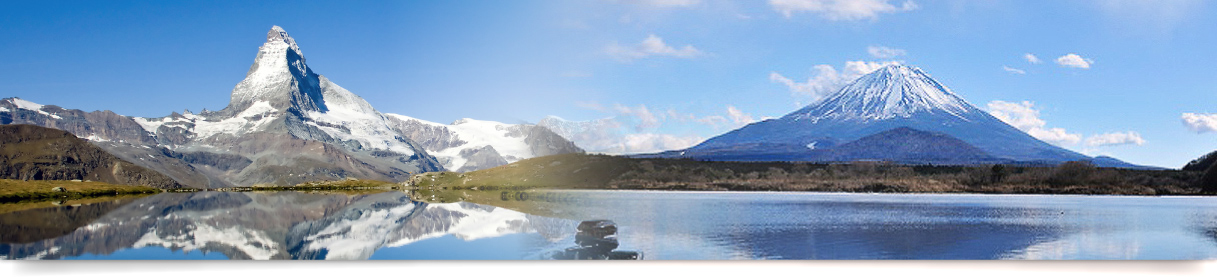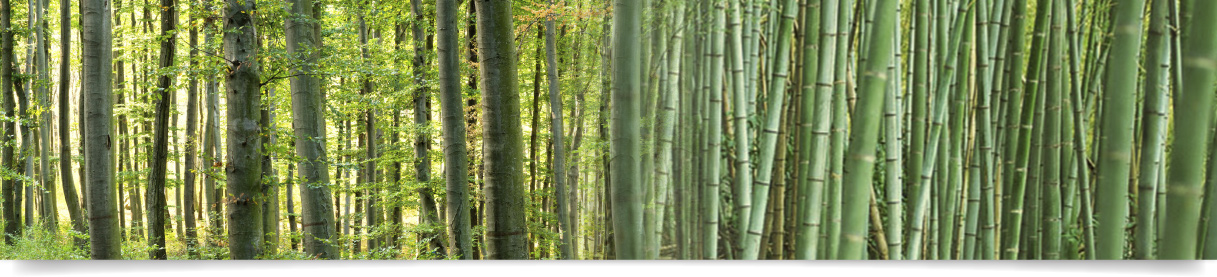150 Jahre bilaterale Beziehungen Schweiz – Japan. Wie weiter?
Die Aufnahme bilateraler Beziehungen zwischen der Schweiz und Japan erfolgte am 6. Februar 1864 aufgrund der Unterzeichnung des ersten Handels- und Freundschaftsabkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Taikun, d.h. dem (vierzehnten und vorletzten) Shogun, Tokugawa Iemochi (1846-1866). Für die Japaner jener Zeit entsprach dieses Datum dem 29. Tag des zwölften Mondes des dritten Jahres von Bunkyu. Dies ist der Grund, weshalb sich Japan und die Schweiz darauf vorbereiten, im Jahre 2014 die ersten 150 Jahre ihrer bilateralen Beziehungen zu feiern.
Welche Überlegungen haben die Schweiz, ein mitten in Europa gelegenes Land, ein Binnenland ohne Marine und ohne Kolonien, veranlasst, wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen mit Japan aufzunehmen, einem Land, welches als isolationistisch galt und welches 9‘674 km östlich von Bern liegt?
Die Schweiz und Japan weisen mehrere Gemeinsamkeiten auf: ein zerklüftetes, gebirgiges Gelände, von welchem nur ein kleiner Teil des Gebiets landwirtschaftlich genutzt werden kann, wenig natürliche Rohstoffe und eine fleissige Bevölkerung. Auch wenn die Schweiz im Vergleich zu Japan nur in geringem Masse erdbebengefährdet ist, so sind doch beide Länder an harte, manchmal grausame Naturgewalten gewohnt, die Respekt verlangen.
Nach dem Ende des letzten Bürgerkrieges, dem Sonderbundkrieg, gab sich die Schweiz in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine neue Verfassung (1848) und trat in eine neue Ära ein, einer Phase der industriellen Revolution und des starken wirtschaftlichen Wachstums. Insbesondere die Schweizer Uhrenindustrie war auf der Suche nach neuen Absatzmärkten.
Japan befand sich zum Ende der Edo-Periode (1603-1868) in Aufruhr. Das Shogunat sah sich auf der einen Seite zwischen dem der Öffnung des Landes abgeneigten Hof des Kaisers, und den innovativen Kräften, die das Shogunat durch eine kaiserliche Regierung ersetzen wollten, und auf der anderen Seite den immer stärker werdenden Forderungen der ausländischen Mächten nach der Öffnung des Landes. Seit der Ankunft von Kommodore Perry und seiner Flotte in der Uraga-Bucht im Jahre 1853 und dem ersten Freundschafts- und Handelsvertrag mit den USA im Jahre 1858 hatte die Shogunat-Regierung ähnliche Verträge mit Holland, Russland, England und Frankreich unterzeichnet.
In Kenntnis dieser Entwicklung forderten industrielle Kreise in der Schweiz bereits 1859 die Bundesregierung auf, eine Mission nach Japan zu entsenden. Es handelte sich dabei um die Mission von Rudolf Lindau (1829-1910), der jedoch nur mit dem Versprechen heimkehrte, wonach Japan die Schweiz prioritär behandeln würde, sobald es bereit wäre weitere Abkommen zu verhandeln.
Ende 1862 ernannte der Bundesrat dann Aimé Humbert (1819-1900) zum bevollmächtigten Minister und beauftragte ihn, mit Japan ein Abkommen auszuhandeln. Fast ein Jahr nach seiner Ankunft im Jahre 1863 und dank der diplomatischen Unterstützung des holländischen Ministers, Dirk Graeff van Polsbroek, konnte Aimé Humbert das Abkommen vom 6. Februar 1864 abschliessen.
Zunächst bedeutete das Abkommen den Beginn zahlreicher und fruchtbarer wirtschaftlicher Aktivitäten der Schweiz, die Waffen, Uhren und Präzisionsinstrumente nach Japan exportierte und wertvolle Seidenfäden in die Schweiz importierte. Die Handelsfirmen Favre-Brandt, Sieber-Hegner, Liebermann-Wälchli etc. liessen sich mit Erfolg in Yokohama und später in Osaka-Kobe nieder.
1868, als das Shogunat endete, um dem neuen kaiserlichen Regime der Meiji-ära (1868-1912) Platz zu machen, durchlebte Japan eine Periode des Bürgerkrieges, welche mit der Verlegung der Hauptstadt von Kyoto nach Edo und deren Umbenennung in Tokio endete.
Unter dem neuen kaiserlichen Regime startete Japan grundlegende Reformen, verbunden mit einer Verwestlichung der Gesellschaft. Oft wird von der „Meiji-Restauration“ gesprochen, tatsächlich handelte es sich jedoch um eine eigentliche „Revolution“ der japanischen Gesellschaft. Die Massnahmen der Regierung zur Abschaffung des Feudalsystems, der Trennung von Buddhismus und Shinto etc. wirkten sich damals bis in die Schweiz aus. Die Glocke des Honsen-ji Tempels von Shinagawa ist ein Beispiel hierfür. Die Glocke wurde entfernt und in die Schweiz exportiert. 1930 gab die Stadt Genf, die inzwischen das Eigentum erworben hatte, die Glocke dem Tempel zurück. Dies führte zu engen freundschaftlichen Banden zwischen Genf und Shinagawa, welche 1991 formalisiert wurden. Es handelt sich um eine der zahlreichen privilegierten Beziehungen, die unsere beiden Länder heute verbinden.
Während Schweizer Produkte - dank der Niederländische Ostindien-Kompanie - den Weg nach Japan bereits in der Edo-Periode gefunden hatten, liessen sich verschiedene Schweizer Produzenten wie zum Beispiel Nestlé, CIBA (heute Novartis) etc. erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Japan nieder.
Die ersten Japaner, die in die Schweiz kamen, waren wohl die Mitglieder der von Tokugawa Akitake (1853-1919) angeführten Delegation im Jahre 1867. Später waren es Studenten wie Oyama Iwao, dem zukünftigen Marschall, der von 1870 bis 1874 in Genf studierte. Diese Tradition wird noch heute mit einem Stipendien-Austausch-Programm auf Nachdiplom-Stufe weitergeführt. Die erste offizielle Delegation des neuen kaiserlichen Regimes, die bekannte Mission von Iwakura Tomomi (1825-1883), besuchte die Schweiz im Juni 1870 anlässlich einer Weltreise, und interessierte sich unter anderem für die dauernde Neutralität, das im Entstehen begriffene Rote Kreuz und das schweizerische Milizsystem.
Vom Ende des 19. bis ins 20. Jahrhundert entwickelte sich Japan auf der internationalen Bühne und obschon der Zweite Weltkrieg ausbrach, erlebte die Beziehung zwischen der Schweiz und Japan nie einen Unterbruch. Die Neutralität der Schweiz erlaubte es ihr während des Konfliktes des Zweiten Weltkrieges, die Interessen der Alliierten auf dem Archipel zu vertreten.
Im August 1945, direkt nach der Bombardierung, besuchten Dr. Marcel Junod und die Vertreter des IKRK Hiroshima und signalisierten mit ihrem Einsatz den Beginn einer neuen Ära der bilateralen Beziehungen.
Schweizer Investitionen und die Einführung neuer Schweizer Technologien förderten den Wiederaufbau Japans. Mit der schrittweisen Integration der Märkte entwickelten sich die bilateralen Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern - zwischen Komplementarität und hartem Wettbewerb, insbesondere im Uhrensektor.
Die besondere Situation der Schweiz im Herzen Europas und dennoch nicht Mitglied der EU, ermutigt zahlreiche japanische Firmen, ihren Europäischen Sitz in der Schweiz zu errichten. Japan und die Schweiz, beide stark exportabhängig, teilen die gleichen Werte bezüglich Freihandel sowie die gleichen Sorgen hinsichtlich der Landwirtschaft und einer ausreichenden Autonomie in der Lebensmittelversorgung.
Das 2009 in Kraft getretene neue Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern bezeugt diese Interessengemeinschaft. Zudem vertiefte sich der wissenschaftliche und technologische Austausch zwischen den beiden Ländern in den vergangenen Jahrzehnten.
Früh hat auch die Schönheit der alpinen Landschaft der Schweiz Touristen aus Japan angezogen, so dass Sicherheitshinweise in den Gebirgseisenbahnen oft auf Japanisch angegeben sind.
So wie der Brand der Holzbrücke in Luzern 1993 die Gemüter der Japaner bewegt hat, die sich in der Folge grosszügig am Wiederaufbau beteiligten, so hat auch das traurige Ereignis der Katastrophe vom 11. März 2011 im Nordosten Japans eine Solidaritätsbewegung in der Schweiz ausgelöst, welche die Bande zwischen den beiden Völkern weiter gestärkt hat.
Eine Feier wie jene anlässlich der 150 Jahre bilateraler Beziehungen ist eine Gelegenheit, über die Vergangenheit nachzudenken und in die Zukunft zu schauen. Aufgrund dieser Überlegung: Welche Rolle können die Schweiz und Japan spielen, um einen Beitrag zum Frieden und Wohlstand unseres Planeten zu leisten?
Philippe A. F. Neeser